F&E-Outsourcing : Auftragsforschung: Die Tücken der Auslagerung
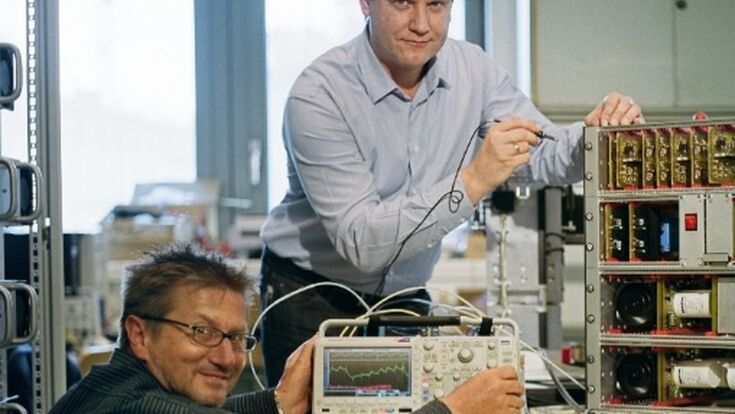
Ein Copy-und-Paste-Projekt war das des Motorenherstellers BRP-Powertrain nie. Denn dafür war die Sichtweise der Gunskirchener zu neu. Anfang 2009 sah sich der Betrieb in seiner Vormontage von Zylinderköpfen für Kleinserien scharf nach Alternativen um. Die Oberösterreicher wollten noch effizienter montieren – mit stärker automatisierten Maschinen „betraten wir deshalb bewusst Neuland“, erzählt Fertigungsleiter Anton Stranzinger-Mayrhauser. Gleich vier unterschiedliche Typen von Zylinderköpfen – für ein- und zweizylindrige Motorräder und solche für Schneeschlitten – wollte der Betrieb erstmals über eine gemeinsame Linie jagen. Mit einer Fachhochschule gab es beim Zulieferbetrieb unzählige positive Vorerfahrungen – doch diesmal landete man mit der Praktikumsarbeit in der Sackgasse: „Unser Stand der bildanalytischen Auswertung wurde nicht erreicht“, musste sich Stranzinger-Mayrhauser nach gut drei Monaten den Rückschlag eingestehen.Es sollte nicht der letzte bleiben. Der automatische Wechsel der drei Roboteraufsätze durfte nicht länger als zehn Minuten in Anspruch nehmen. Ein Etappenziel, das nun ein Diplomand einzulösen hatte – aber auch er scheiterte. „Erst als ein Industriepartner in die Bresche sprang, war das Projekt Monate später wieder auf Kurs“, schildert der Fertigungsleiter. Der BRP-Mann will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Seine Erfahrungen mit externen Forschern seien durchweg positiv. Trotzdem zieht er eine Lehre aus den Problemen des wissenschaftlichen Beistands. „Wir berücksichtigen die Technologiekomplexität jetzt stärker bei der Partnersuche“, sagt Stranzinger-Mayrhauser. Scheitern „als Möglichkeit“. Mehr als 300 anwendungsorientierte Forschungsprojekte von Unternehmen bis 100 Mitarbeiter nahm die KMU-Forschung Austria unter die Lupe. 16 Prozent davon überzeugten technisch, nicht aber wirtschaftlich. Drei Prozent der Projekte waren Totalcrashs. Fasst man F&E weiter, ist das Scheitern „immer als Möglichkeit inkludiert“, meint Martin Kozek, Forscher am Institut für Mechanik und Mechatronik an der TU Wien. Er ist ein Vielforscher, von der Industrie hochgeschätzt und selten mit weniger als zehn Projekten gleichzeitig betraut. Als Projektleiter trägt er die Gesamtverantwortung für die Projektdurchführung – das reicht von der Vertragsgestaltung bis hin zur Abwicklung von Förderansuchen. Daneben nimmt er seine Rolle als Senior Researcher ernst. In jedem fünften bis zehnten Projekt, so meint er, erreichen Auftragsforscher nicht das übergeordnete Ziel. Verstünden Betriebe den Begriff Forschungsrisiko richtig, „haben sie damit aber kein Problem“, sagt Kozek.Was die Sache verkompliziert: Die EU stuft Österreich als Technologiefolgeland ein. Betriebe würden in Projekten das Risiko scheuen. „Man bleibt häufig lieber bei der konservativen, sicheren Idee“, beobachtet auch Kozek. Der Druck auf Forscher, die Ziele zu erreichen, sei deshalb größer. Die Motivation, extern forschen zu lassen, sei zudem nur selten das Ergebnis von strategischer Planung. „In vier von fünf Fällen“, konstatiert Kozek, „kommen wir erst bei Ressourcenengpässen im Betrieb oder sonstigen Schwierigkeiten ins Spiel“. Selbst in den kleinsten Projektformen wird dann unmögliches eingefordert. „Da wird in Diplomarbeiten gestopft, was kaum in zweijährige Dissertationen passt“, berichtet Kozek. Fortsetzung auf Seite 2.
Projektmanagement „für Notfälle“. Kein Projektleiter sei unfehlbar, meint Wilfried Sihn, Chef von Fraunhofer Austria. „Aber es gibt professionelles Projektmanagement, mit dem man für Notfälle und Katastrophen gewappnet ist.“ Er war dabei, als es bei einem Betrieb kürzlich genau zu einem solchen Notfall kam. „Aus Kostengründen wurde der Formenbau für ein Spritzgusswerkzeug an einen ausländischen Lieferanten vergeben“, erinnert sich Sihn. Nach einigen Monaten – die Halbzeit des Projekts war längst erreicht – entpuppte sich der Lieferant als Rohrkrepierer. Der Betrieb hatte aber Vorkehrungen getroffen. Für den Fall, dass ein Lieferant ausfällt, lag eine Marktübersicht „schon fixfertig in der Schublade“, lobt Sihn.Wer aber soll an den Schalthebeln sitzen? Ein langgedienter Projektprofi? Oder jemand aus der zweiten Reihe, der sich bewähren darf? „Der erste Weg ist sicherer“, meint Sihn. Der zweite kann aber auch gut sein. Vorausgesetzt, der Leiter verliert weder Kosten, Zeit noch Forschungsziel aus den Augen. Meilensteinpläne sind hilfreich. Wie sie aussehen, lernt man in Projektmanagementseminaren. Auch an der TU Wien können sie belegt werden. „Es ist das beliebteste Fach bei Ingenieuren“, erzählt Sihn. Weil es jeder einmal braucht – im Unterschied „zu numerischer Mathematik“, so Sihn.Wie gelebtes Projektmanagement aussieht, dokumentiert ein aktuelles Projekt von Fraunhofer Austria. „Da haben wir ein Live-Beispiel“, erzählt Sihn. Die Wiener greifen einem Dienstleistungsbetrieb bei ihrem Forschungsprojekt unter die Arme. Mit mehreren Leuten aus dem Unternehmen führte Sihn schon Gespräche. „Doch das Projektziel definierten alle anders“, stellte der Fraunhofer-Chef fest. Klarheit musste her. Also holte er sie alle an den Tisch. Selbst der Chefberater des Betriebs gab danach zu, „mit ganz anderen Vorstellungen ins Projekt gegangen zu sein“, schmunzelt Sihn. Kein Sparzwang bei Meilensteinen. Projektmanagement wird auch an den auf KMU-Forschung spezialisierten ACR-Instituten gelebt. Innovationsscheck, Machbarkeitsstudie oder Großprojekte: Die 16 Mitgliedsinstitute – auch Spezialisten für Mikrostruktur- und Werkstofftechnik sind darunter – wickeln jedes Jahr 1200 Forschungsprojekte ab. Entwickelt wird nicht nur am Schreibtisch. Deshalb ist die Erfolgsquote hoch. „Wir begleiten Firmen bis zum fertigen Produkt“, schildert ACR-Geschäftsführer Johann Jäger. An der FH Joanneum in Kapfenberg wird dem Projektmanagement ein ebenso großer Stellenwert eingeräumt. „Unsere Forscher haben allesamt eine mindestens einsemestrige Ausbildung in Projektmanagement genossen“, erzählt Sabine Hanusch, Lehrgangsleiterin International Supply Management. In einem aktuellen Forschungsprojekt mit RHI, AT&S, voestalpine und der FH Oberösterreich arbeiten die Wissenschaftler gerade einen Leitfaden zur Optimierung des Beschaffungswesens aus. “Eine transparente Roadmap ist uns wichtig”, sagt Hanusch. Nachsatz: “Lieber zuviele als zu wenige Meilensteine in einem Projekt.” Fortsetzung auf Seite 3.
Projekthandbuch. Voraussetzung für ein rasches Einarbeiten und gutes Vorankommen im Projekt ist laut TU Wien-Auftragsforscher Martin Kozek ein Projekthandbuch. „Das ist absolute Grundvoraussetzung, selbst dann, wenn es die Industriepartner nicht fordern“, sagt er. Das 20 bis 40 Seiten starke Handbuch wird zu Projektbeginn im Team erstellt und dokumentiert Schritt für Schritt die bevorstehende Arbeit. Das inhaltliche Gerüst kommt stets vom Chef persönlich. „In den Unternehmen hört man häufig, dass F&E frei von Regeln sein sollte“, meint Kozek. Er ist anderer Meinung. Das Buch sichere die Freiheit nach außen erst wirkungsvoll ab. “Damit ist transparent festgelegt, was zum Projekt gehört und was nicht”, sagt Kozek. Zudem würden strikte Vorgaben “Disziplin aufzwingen”. Erfahrung als Hartwährung. Um im Jahr 40 bis 50 Projekte erfolgreich zum Abschluss zu bringen, müssen andere an der Wunderlampe reiben. Nicht Friedrich Bleicher von der TU Wien. Der Vorstand am Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik gilt als einer der profiliertesten Auftragsforscher im Lande. Sei es der Automatisierungsspezialist B&R, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann oder der Maschinenbauer Anger Machining – bei Bleicher drücken sich die Großen der Industrie die Klinke in die Hand. Erfahrene Leute sind für den TU-Forscher ganz klar die Hartwährung im Auftragsforschungsbetrieb. Etwa Projektmitarbeiter, die sich mit der Dissertation schon erste Lorbeeren verdient haben. Oder Teamleiter, die den „nötigen Pragmatismus mitbringen und nicht nur die dritte Nachkommastelle berücksichtigen“, betont Bleicher. Nur einmal, erzählt Bleicher, sei eine Projektidee nicht aufgegangen. Ein Industriebetrieb assoziierte mit dem Projektabschluss ein optimiertes Schleifverfahren. Das konnte so nicht realisiert werden. Bleicher führt dafür mehrere Gründe ins Treffen. Unter anderem eine signifikant schlechtere Kommunikation. „Der Austausch verlief von Anfang an schleppend“, erinnert er sich. Er will die Schuld aber nicht nur bei anderen suchen. „Wir haben die Komplexität des Themas unterschätzt“, gibt er zu.Anderthalb Jahre lief das Projekt. Hatten sich die Schwierigkeiten nicht angekündigt? Das Grundverständnis von Forschung sei, „nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen“, meint Bleicher. Jüngere Kollegen würde er nicht einfach so vom Projekt abziehen.Beim Auftraggeber war man ob der Pleite freilich not amused. Es überwog die Enttäuschung, „Zeit und Energie verloren zu haben“, bringt Bleicher Verständnis dafür auf. Wenngleich sein Vorstoß hinter den Kulissen sehr wohl für einen Erkenntnisgewinn gesorgt haben dürfte. Motiviert durch Bleichers Forschung adaptierte ein anderer Partner parallel dazu das bestehende Konzept und erzielte alsbald „eine Verbesserung des Schleifverfahrens um den Faktor Zwei“ wie der Forscher meint. Sherpa-Teams statt Einzelsportler. Kurzzeitig dürfen die Wogen in Projekten schon einmal hochgehen. Doch „insgesamt muss die Chemie stimmen“, meint Wilfried Sihn, Chef von Fraunhofer Austria. Das gilt besonders für jene, die durchs Mikroskop schauen oder an der Maschine schrauben – also typische Akteure aus dem zweiten Glied. Streithähne sind hier Gift für einen positiven Projektausgang. Gerade auch, weil immer häufiger so genannte Sherpa-Teams zum Zug kommen. Ein Ansatz, bei dem sich die Projektleitungen nur sporadisch sehen müssen. „Die Akteure darunter sind aber teilweise täglich in Kontakt“, weiß Sihn.Aufgeschlossenheit gegenüber der Industrie demonstrieren die Forschungspartner allesamt. „Wir schließen niemanden aus“, meint Johann Kastner, Forschungleiter an der FH Oberösterreich. Etwas enger fasst es TU Wien-Forscher Martin Kozek. „Wer uns als verlängerte Werkbank sieht, ist bei uns falsch“, bezieht er klar Position. Dass Firmen eine exakte Kopie bestehender Marktlösungen haben wollen, soll auch vorkommen. „Da ist die Freude sicher nicht überschäumend“, lacht ein Forscher. Zauderer werden bestraft. In unsichere Gewässer kommen Projekte häufig dann, wenn ein Personalwechsel ansteht – egal, ob hüben oder drüben. Nicht jeder Neuzugang fühlt sich für die Forschungsoffensive des Vorgängers verantwortlich. „Das kann die Projektarbeit massiv belasten“, meint Forschungsleiter Johann Kastner von der FH Oberösterreich. Wesentlich seien deshalb stets fixe Ansprechpartner – „das gilt für beide Seiten“, so Kastner. Mit dem Schicksal ins Hadern kommen forschende Betriebe auch bei schlechtem Timing. So flutschte eine sicher geglaubte Prozesstechniklösung einem Betrieb in den Krisenmonaten durch die Hände, die vorher in monatelanger Arbeit an der TU Wien entstand. Der Betrieb musste eisern sparen – er war nicht einmal in der Lage, „das Patent zu übernehmen“, erinnert sich Martin Kozek vom TU Wien-Institut für Mechanik und Mechatronik. Auch der Illusion, dass der Mitbewerb schläft, sollten sich Betriebe nicht hingeben. Dem Entwicklungsleiter eines heimischen Technologiebetriebs gab TU Wien-Forscher Friedrich Bleicher noch kürzlich einen wohlgemeinten Rat. „Das wäre doch genau die richtige Technologie für euch“, stieß der Forscher den Betrieb mit der Nase auf eine Innovation. Dort lebten auch starke Sehnsüchte auf. Doch gezögert wurde einen Moment zu lange. Der Mitbewerb war schneller und meldete unvermeidlich „ein Patent an“, erinnert sich Bleicher. Überschaubare Projekte. Dass Betriebe alle bisherigen Projektziele über Bord werfen, ist in der Auftragsforschung eher die Ausnahme. Kleinere Abänderungen sind aber – selbst kurz vor dem Ziel – üblich. „In jedem dritten Projekt gibt es den Wunsch, die Marschroute abzuändern“, erzählt Johann Kastner von der FH Oberösterreich. Forscher, die umdisponieren müssen, proben dann zwar meist nicht den Aufstand. Änderungsanträge seien nur „ein formalistisches Spiel“, meint TU Wien-Forscher Martin Kozek nüchtern. Übertreiben sollten es die Auftraggeber aber nicht. Taucht ein völlig neues Problem am Horizont auf, sollten Betriebe besser dem Reiz des Hineinreklamierens widerstehen. Denn muss das Institut die Personalressourcen aufspalten, kann das in die Hose gehen. „Unter Umständen werden beide Ziele verfehlt“, sagt ein Forscher. Und dann wäre die Projektkatastrophe perfekt. Daniel Pohselt
